Wieviel du ist gut für mich?

Gedanken zu Integrität und Kooperation
„Wann ist man zu altruistisch und gibt sich dabei selbst auf? Und wann zu egoistisch?“ Diese Frage kam auf nach einem Volontär-Arbeitseinsatz, bei dem der Fliesenboden im Seminarhaus fertiggestellt wurde. Die Arbeit dauerte länger als geplant, trotzdem blieben alle dabei.
Die Frage nach dem rechten Maß bezüglich ehrenamtlichen Engagements und Eigenzeit stelle ich mir
selbst immer wieder. Und ich bin da auch in regem Austausch mit meinen philosophischen Schülern. Deshalb möchte ich auch mit Ihnen, meinen Lesern, meine Reflexionen teilen. Das Thema ist für jeden interessant. Vor allem aber für Menschen, die sozial und/oder politisch engagiert sind. Und da wir eine multiple Krise erleben, sind viele Menschen ehrenamtlich aktiv.
Was alle dabei antreibt, ist die Tugend der Verantwortung. Wir wollen eine Antwort geben auf die aktuelle Situation der Welt, die Nöte und Sorgen der Mitmenschen. So empfinden wir eine innere Verpflichtung und eine Notwendigkeit, zu handeln. Es entsteht ein Verantwortungsbewusstsein und vor allem auch ein Verantwortungs-Gefühl. Dieses setzt uns in Bewegung. Verantwortungs-Geist oder Verantwortungs-Bewusstsein weisen auf die mentale Dimension der Verantwortung hin. Der Begriff „Verantwortungs-Gefühl“ jedoch auf die Herzensdimension. Wenn ich diesem Gefühl nachspüre, bemerke ich, dass es mich in Bewegung setzt. Dass ich etwas tun will. Ich habe das Bedürfnis, mich für soziale Gerechtigkeit, einen nachhaltigen Lebensstil und Frieden einzusetzen. Wer für die Situation der Welt und für andere Menschen Verantwortung übernehmen will, sollte bei sich selbst anfangen. In unserer Philosophieschule gibt es deshalb eine ethisch-moralische Ausbildung zur Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung.

Selbstfürsorge
Dieses Thema ist auch Inhalt des philosophischen Dialogs „Alkibiades“ von Platon. Sokrates führt den machthungrigen aufstrebenden Draufgänger Alkibiades zur Erkenntnis, dass er erst mal sich selbst erkennen muss, bevor er als Politiker für andere Menschen Verantwortung übernimmt. Er möge erst sein Selbst kultivieren, bevor er sich um andere kümmert. Und weiter erklärt er Alkibiades dann, dass Selbstfürsorge in erster Linie Seelenkunde ist. Selbstfürsorge bedeutet also, sich um die eigene Psyche kümmern – Seelsorge.
Mit dem „Augengleichnis“ erzählt Sokrates dem jungen Mann, wie wichtig die Begegnung mit anderen Seelen ist, um sich selbst zu erkennen. Das Auge spiegelt sich im Auge eines anderen Menschen, und zwar in der Pupille, die der beste Teil des Auges ist. Die Seele erkennt sich selbst, wenn sie in den besten Teil der Seele eines anderen blickt, und zwar in den vernunftbegabten.
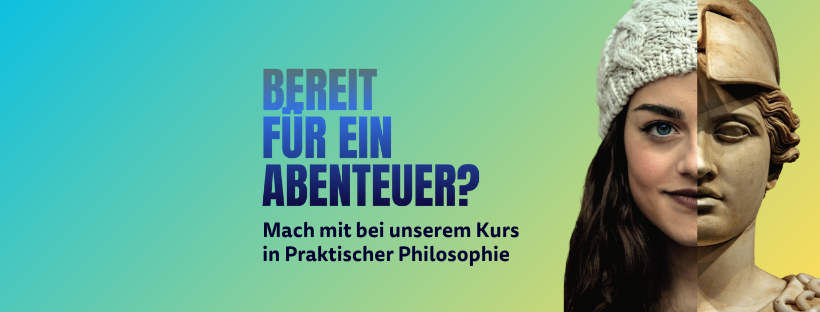
Dieser Seelenteil (in anderen Werken erklärt Platon, dass es auch den mutvollen und den begehrenden Seelenteil gibt) kann Wissen und Einsicht erlangen und so auch Zugang zum Göttlichen gewinnen. Wenn sich die Seele der Vernunft bedient, dann handelt sie typisch menschlich im besten Sinne des Wortes und kommt dem Göttlichen am nächsten. Und erst dann ist der Mensch für politische Tätigkeiten vorbereitet. Das erklärt Platon ja auch in seinem Höhlengleichnis: Jeder Politiker muss zuerst Philosoph sein.
Politisch zu handeln bedeutet für mich hier, sich für das Allgemeinwohl und öffentliche Belange einzusetzen. Und jeder „Politiker“ steht im Spannungsfeld zwischen der persönlichen und der gesellschaftlichen Dimension. Jeder Volontär ist auch für seine Integrität zuständig, damit er handlungsfähig bleibt. Ein schönes Symbol dafür ist die Sicherheitsunterweisung im Flugzeug: Wenn Sauerstoffmasken herunterfallen, möge man erst seine eigene aufsetzen, bevor man anderen Mitreisenden hilft. Sonst ist man ein hilfloser Helfer.

